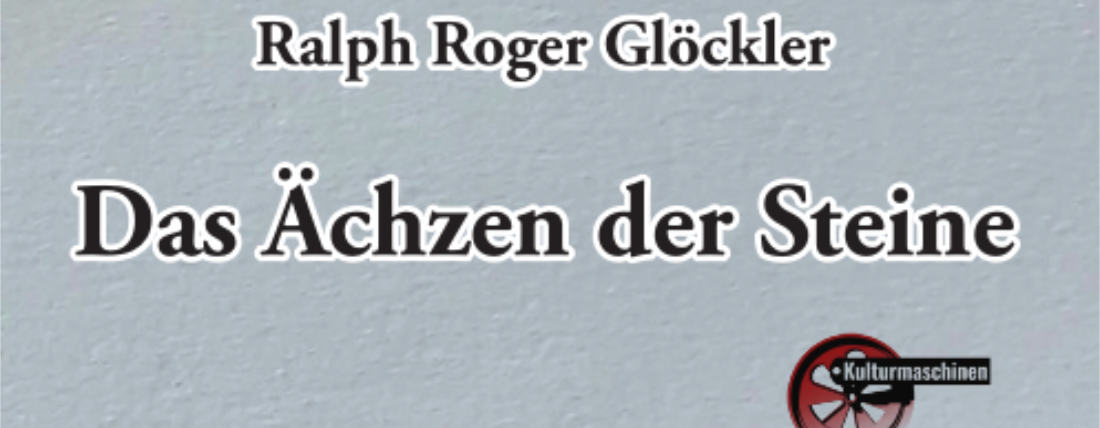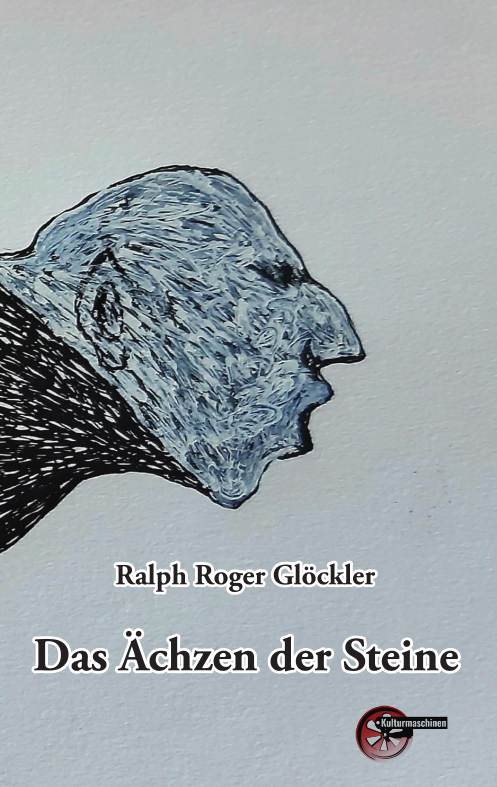 Über das Buch:
Über das Buch:
Ralph Roger Glöckler entwirft mit poetischer Präzision und tiefenpsychologischer Schärfe das Bild eines erschütternden Verbrechens. 1987 tötete ein Mann in nur drei Stunden sieben Menschen. Glöckler begibt sich auf eine beeindruckende Reise durch die Dunkelheit des Tätergeistes und schreibt eine literarische „Leidensstudie“, die das fragile Zusammenspiel von Gedanken, Wahrnehmung und Wahn hinterfragt.
(Das Buch ist die Neuausgabe des Romans „Rückkehr ins Dorf“, 2019, Größenwahn Verlag, Frankfurt)
Textauszug:
Der Engel überm Dach von Großmutters Haus, ein in zerfetzte Klamotten gehüllter Bote des Lieben Gottes, hebt das Megafon vor den Mund und verkündet den Leuten im Dorf frohe Botschaft: Die Schwangerschaft von Fräulein Maria, der Erzeugerin des Schreibers dieser Zeilen, sei Frucht unbefleckter Empfängnis, hätten Großmutter und ihre Tochter doch einen dieser gewissen Herren vor einigen Wochen davon überzeugen können, der Heilige Geist gewesen zu sein und den in einem armen Bauernhaus geborenen Buben an Kindesstatt anzunehmen, ich sehe es vor mir, hätte man meinen Geburtstag also auf den 25. Dezember eintragen lassen, wäre ein richtiger Herr Jesus aus mir geworden.
Die Geschichte meiner Rückkehr ins Dorf, die ich trotz vagen Anfangs und eines Endes, das keines ist, niederschreiben will, wird Fragment bleiben, weil mir nach all den Jahren nur gewisse Erinnerungen geblieben sind, die, bevor ich dieses Tollhaus in der Frühe verlasse, um arbeiten zu gehen, bereits unlesbar sein werden. Es hat lange gedauert, an die richtige Tinte zu gelangen, um diese Blätter nach einer Weile wie unbeschrieben wirken zu lassen. Gut so. Gehe ich doch niemanden etwas an. Oder?
Auch dürfe man sich gar nichts dabei denken, so die Megafonstimme, wenn es bei der Vaterschaft nicht ganz katholisch zugegangen sei, schließlich bestehe das Leben aus faulen Kompromissen. Der Himmlische Vater drücke gerne ein Auge zu, wenn es darum gehe, einen überzeugenden Josef zu finden, vor allem hier bei uns, hinter den Bergen. Nein, der Engel über Großmutters Haus ist kein Bote des Lieben Gottes, sondern ein Verstoßener, durchs Weltall stürzender Schwätzer, der auf unserem Dach aufgeschlagen und davon herunter gerutscht ist. Nun liegt er zerschmettert neben dem Pfirsichbaum, kann vor Schmerzen weder leben noch sterben, und das Megafon gibt nur seltsame Geräusche von sich. So ist mein Geburtstag auf den 23. Dezember eingetragen worden.
Das Ächzen der Steine
Erscheint im März 2025
Umfang ca. 200 Seiten
Bestellbar über den Buchhandel oder direkt beim Verlag
https://kulturmaschinen.com
Kulturmaschinen Verlag, Ochsenfuhrt, 2025
ISBN
978-3-96763-346-7 (kart.) € 15,00
978-3-96763-347-4 (geb.) € 25,00
978-3-96763-348-1 (.epub)
|
Luciano Caetano da Rosa “Das Ächzen der Steine” Gedanken zu dem Roman von Ralph Roger Glöckler Dieses Buch ist keine einfache Lektüre, weil die feinsinnige Erzähltechnik einen kreativen Leser verlangt, der in der Lage ist, die jeweiligen Erzähler zu unterscheiden. Die detaillierten Beschreibungen, vielleicht ein Einfluss von Alain Robbe-Grillets >Nouveau Roman<, erlebte Rede, >stream of consciousness<, in komplexen syntaktischen Gefügen mit verbalen, modal angereicherten Sequenzen (mögen, sollen, wollen, dürfen …), die es erlauben, zu erahnen oder besser zu verstehen, was im Roman geschehen ist oder hätte geschehen können, ja, geradezu das Mithören dessen, was der andere denkt, sowie die zu bemerkende, komplexe Arbeitsvorbereitung für dieses Werk, erwecken den Wunsch, den Autor zu beglückwünschen, der sich nicht nur in die menschlichen Beziehungen einfühlt, sondern auch in das vielschichtige soziale Umfeld. Obwohl die Lektüre viele Fragen aufwirft, die nicht zu beantworten sind, steht hier nie die schriftstellerische Meisterschaft zur Diskussion, das Deutsche, bei dem der Fremdsprachler viele Worte kennenlernen kann, die selbst Deutschen wenig vertraut sein mögen, z.B. >Versonnenheit<, oder die durchgehaltene, stilistisch gelungene Erzählkunst. Dieses Werk ist eine Synthese aus Fiktion und, nennen wir es einmal so, sozialer Anthropologie, auch wenn das Ergebnis dieser Arbeit, ihr Mehrwert, auf ästhetischem Gebiet, also im Literarischen liegt. Ich möchte in diesem Zusammenhang einen Satz von José Cardoso Pires zitieren, einem der glänzendsten portugiesischen Prosaschreiber des 20. Jahrhunderts, um zu verdeutlichen, dass es sich bei „Das Ächzen der Steine“ um eine >prosa ficcional dissertada a partir da realidade< handelt, einer auf Wirklichkeit beruhenden Prosaerfindung, und schließe den Gedanken an, dass Wirklichkeit und Fiktion, Fiktion und Wirklichkeit einander stetig neu bedingen. Die Geschichte menschlichen Leidens erhält mit diesem Werk ein Dokument des himmelschreienden Protestes gegen das Universum. Die Dialektik, die sich im Deutschen so gut in den Begriffen von >Täter< versus >Opfer< ausdrückt, mag dazu führen, dass es, berechtigt oder nicht, niemanden gibt, der völlig schuldlos wäre. Martos Mord an Frau und Kindern ist ein monströses Verbrechen, das wohl nur derjenige begehen kann, der nicht ganz bei Verstand ist. Martos Krankheit rührte aus dem täglichen familiären Verhalten und der gebrochenen Wahrnehmung dessen her, was schon geschehen war und weiterhin geschehen würde, einer bei ihm jedoch pathologisch gesteigerten Wahrnehmung, auch wenn es zwischendurch immer wieder Augenblicke geistiger Klarheit gegeben haben mag. Was der Autor bei der Arbeit an diesem Buch empfunden, welche Konflikte sich ihm dabei eröffnet haben mögen, kann nur er selbst beantworten: Ein nicht ungefährliches Spiel mit dem Feuer. Davon einmal abgesehen, halte ich das dabei entstandene Werk für brillant. (Aus dem Portugiesischen von RRG) |
Sven j. Olsson im Gespräch mit Ralph Roger Glöckler über seinen Roman »Das Ächzen der Steine«, Kulturmaschinen Verlag, Ochsenfurt, 2025
Lieber Ralph Roger Glöckler, der Roman „Das Ächzen der Steine“ geht auf einen Mordfall in Portugal zurück. Das Buch liest sich aufregend, fesselnd und zeugt von einer Neugier und dennoch stellt sich die Frage: Warum diese Geschichte?
RRG: Figuren, die Gratwanderungen unternehmen und meistens dabei scheitern, haben mich schon immer fasziniert. Nicht umsonst habe ich ein Zitat aus Büchners »Woyzeck« dem Roman vorangestellt. Die Morde waren damals die Sensation! Wir alle waren entsetzt und fasziniert zugleich. Nach kurzer Zeit wurde der Täter in einem Stall gefunden. Das dabei aufgenommene Foto zeigt einen Mann, der wie ein Ecce Homo auf mich wirkte: Einer der durch großes Leiden gegangen und, nach versuchtem Selbstmord, nun erleichtert ist, gefunden worden zu sein. Der Ausdruck des Gesichtes hat mich spontan angeregt, mehr über die Hintergründe des Verbrechens zu erfahren.
An dieses Warum schließt sich sogleich die Frage an, wie recherchiert ein Schriftsteller eine Mordserie? Wie kriechen Sie in die Gehirnwindungen eines Mörders?
RRG: Die Faszination hielt an, aber es dauerte etwa drei Jahre, bis ich in der Lage war, mich dem Thema zu widmen. Es stellte sich die Frage, womit bei der Recherche anzufangen: Zuerst einmal viele Zeitungsberichte lesen, herauszufinden, wer welche Rolle spielte. Dabei fiel mir der Priester auf, der dem Mann nach der Gefangennahme die Beichte abnahm. Ich setzte mich mit ihm in Verbindung, traf ihn zu langen Gesprächen über den Täter und fuhr mit ihm an einige der Tatorte. Es gelang mir, den Verteidiger, den psychiatrischen Gutachter der Verteidigung zu sprechen, einen Gefängnispsychiater und später die Mutter des Mörders, von der ich nicht weiß, ob sie noch lebt. Irgendwann hatte ich den Wunsch, den Mann selbst zu treffen, der im Gefängnis einsaß. Ich war so kühn, ihm einen Brief zu schreiben und meinen Besuch anzukündigen. Natürlich wurde er abgefangen und mir bedeutet, dass ich kein Recht hätte, zu kommen, würde man mich doch sofort abweisen. Es war mein Glück, dass ich es über Bekannte im Justizministerium erreichte, eine Besuchsgenehmigung zu erhalten, bis man mich aufforderte, die Treffen wieder einzustellen. So konnte ich den Mann verschiedentlich aufsuchen und mit ihm sprechen. Ich versuchte, ihn in meine Arbeit einzubeziehen, um ihm zu zeigen, was ich mache. Er sollte nichts gegen ihn Gerichtetes vermuten. Wir sprachen zuerst über die Namen, die einzelne Figuren erhalten sollten. Dazu gäbe es viel zu erzählen, was den Rahmen dieses Gespräches sprengen würde. Die Tat selbst, seine Motive, habe ich nicht angesprochen, wollte nicht an Wunden kratzen. Ich machte mir einen Reim auf das, was er mir erzählte.
Sie haben den ›echten‹ Mörder, der der Geschichte zugrunde liegt, im Gefängnis besucht. Ein schwieriges Unterfangen? Wie haben Sie ihn dazu bekommen, mit Ihnen zu reden?
RRG: Das war gar nicht so schwer, im Gegenteil, er hat es, glaube ich, gut gefunden, dass sich jemand, sogar ein Ausländer, für seinen Fall interessiert, kein Journalist, der eine sensationelle Story braucht, sondern ein Autor, der ein anderes, persönlicheres Interesse an ihm hatte, dem es nicht darum ging, die Scheußlichkeit des Verbrechens herauszuarbeiten. Vermutlich war da auch ein narzisstisches Element, schließlich gab es keinen zweiten Fall wie den seinen.
Ich kann mir vorstellen, dass viele, die an einem solchen Verbrechen beteiligt sind, Hemmungen haben, darüber zu sprechen. Wie sind Sie mit diesen Vorbehalten umgegangen?
RRG: Ich denke, dass man den seelischen Zustand, vielleicht auch die Erkrankung bedenken muss, um diese Frage zu beantworten. Er sprach über das Geschehen, als wäre er
Protagonist in einem abgedrehten Film gewesen. Das habe ich beim Gespräch über die Namensgebung der einzelnen Figuren schon bemerkt. Als würde er einem fremden Geschehen gegenüberstehen. Ich hatte den Eindruck, dass er wie von außen auf sich und diese Periode blickte, sie geradezu abspaltete. Hätte er sich damit identifiziert, wäre er vermutlich völlig wahnsinnig geworden. Das kann keiner aushalten.
Herr Glöckler, die Frage klingt komisch, deshalb will ich den Hintergrund gern erklären. Als ich beim letzten Wort angekommen war, hatte ich das dringende Bedürfnis wieder vorn anzufangen, weil mir schwante, ich könnte noch mehr in der Geschichte finden, denn beim ersten Lesen. Wie oft lesen Ihre Leser*innen Ihre Bücher?
RRG: Das kann ich gar nicht beantworten. Ich weiß, dass Leser oft anfangen, meine langen, sehr langen Sätze laut zu lesen, um über Rhythmus und Klang in den Text zu finden. Ich versuche allerdings oft, vieles offen zu lassen, um den Leser zu zwingen, selbst weiterzudenken und den Stoff auf sich wirken zu lassen. Ich möchte nicht, dass der Leser das Buch zuklappt und denkt, aha, so war das also. Das ist der schnellste Weg, ein Buch zu vergessen. Das Thema soll seinen Reiz behalten, im Leser fermentieren, um sich weiterhin zu entfalten. Es widerstrebt mir, erklärende Behauptungen in den Raum zu stellen, dafür habe ich selbst zu viele Zweifel. Ich bin nicht der allwissende Erzähler, sondern einer der miterlebt. Da kann man nicht alles wissen. In diesem Buch spielt auch das Changieren der Stimmen eine Rolle, wer sagt was, wer hat was geschrieben, manches bleibt offen, obwohl die einzelnen Stimmen mehr oder weniger definiert sind. Es geht ja um den Raum der Ungewissheit, in dem der Täter lebt. Was ist Fakt, was Inszenierung oder gar Delirium. Kein Wunder, wenn der Leser immer wieder versucht, noch mehr herauszufinden.
Im Roman verschwinden manchmal die Ebenen, die erzählenden Personen, der Text rückt auf eine Ebene, bei der man, beim Lesen, das Gefühlt hat, dem Denken einer anderen Person zuzuhören. Wie hat sich diese Form des Textes entwickelt.
RRG: Ich mag es, schreibend in die jeweilige Person zu schlüpfen, sie von innen wahrzunehmen, um auch wieder Distanz suchend von außen auf sie zu blicken. Die Übergänge sind fließend. Je mehr ich mich mit den Figuren eingelassen habe, umso mehr war ich gezwungen, mich mit ihnen zu identifizieren, konnte nur so am meisten über sie erfahren. Fremderkenntnis als Selbsterkenntnis oder vice versa. Wie auch immer. Dazu gehört ein wenig Mut, weil man plötzlich wahrnimmt, wozu man selbst fähig sein könnte. Es treibt einen an die eigenen Grenzen, was nicht nur schmerzhaft, sondern erschreckend sein kann. Die Form hat sich, um auf die Frage zurückzukommen, von alleine entwickelt. Nur so kam ich mit den Protagonisten weiter. Dieses Buch ist keine Fallstudie, keine Dokumentation, sondern ich habe versucht, Themen zu variieren, die ich bei der Recherche entdeckte habe. Auf Fakten basierende Fiktion.
Dem Roman fehlt das Anklagende, genauer: er verzichtet auf die Anklage. Wie sehr hat da der Autor den Menschen Ralph Roger Glöckler überstimmt? Oder anders: ist die Entscheidung auf den anklagenden Ton zu verzichten, der Kunstgriff, der uns dem Denken des Täters näherbringt?
RRG: Es lag mir von Anfang an fern, den Täter anzuklagen. Ich wollte nur wissen, wer er ist, was ihn dazu gebracht hat, zu tun, was er getan hat. Und ich wusste vom ersten Foto an, dass es sich um einen gequälten Menschen handelte, dessen Taten nicht zu rechtfertigen, allenfalls bis zu einem gewissen Grad zu verstehen sind. Nein, es ist kein Kunstgriff, sondern ich wollte gar nichts anderes, als in diese schwierige Seele einzusteigen, jenseits aller Moral und gesellschaftlicher Selbstgerechtigkeit. Es hat zwanzig Jahre und einige Krisen gedauert, bis ich zu dieser Form gefunden habe.
Obwohl Sie den Mörder nicht anklagen, verdammen, haben Sie eine große Empathie für die Opfer. Ein großer Spagat.
RRG: Der Mörder ist auch ein Opfer, ebenso sind die Opfer des Verbrechens fehlbare Menschen. Beide zusammen schreiben die Geschichte. In meiner Zuwendung sind alle gleich, auch habe ich selbst erfahren, wie nah einer an Grenzen geraten kann. Manchmal sind sie fließend. Der große Unterschied besteht darin, ob man sie überschreitet oder fähig bleibt, es nicht zu tun. Niemand sollte sicher sein, ob ihn eine Extremsituation nicht auch dazu bringen könnte, Grenzen zu sprengen, also ein Verbrechen zu begehen.
Es wird viel über Triggerwarnungen gesprochen, im Film, auch im Buch. Braucht Ihr Buch eine Triggerwarnung?
RRG: Das kann ich nicht ausschließen. Ich kenne Menschen, denen ich das Buch besser nicht geben sollte. Vor allem depressiven und ängstlichen Personen. Das Schwanken zwischen Wirklichkeit und Wahn, was ich im Buch darstelle, kann verstörend wirken. Ein durchaus quälerisches Werk, das jemanden dazu verführen könnte, nicht nur an andere, sondern auch an sich selbst Hand anzulegen. Wie der Täter es zuletzt getan hat, unabhängig von meinem Buch, von dessen Abschluss und Veröffentlichung er nichts wusste. Er hat sich vor kurzem getötet.